MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Faszination für Süßigkeiten, selbst nach einem üppigen Mahl, ist ein Phänomen, das viele kennen. Forscher des Max-Planck-Instituts für Stoffwechselforschung haben nun herausgefunden, dass dieses Verlangen tief im Gehirn verwurzelt ist. Die gleichen Nervenzellen, die uns nach einer Mahlzeit satt fühlen lassen, sind auch für das Verlangen nach Süßem verantwortlich.
Die Entdeckung der sogenannten „Dessert-Magen“-Reaktion wirft ein neues Licht auf die neuronalen Mechanismen, die unser Essverhalten steuern. In einer Studie mit Mäusen fanden die Forscher heraus, dass selbst vollständig gesättigte Tiere weiterhin Zucker konsumierten. Diese Ergebnisse wurden in der renommierten Zeitschrift Science veröffentlicht.
Im Zentrum dieser Forschung stehen die POMC-Neuronen, eine Gruppe von Nervenzellen, die sowohl Sättigung als auch das Verlangen nach Zucker beeinflussen. Sobald die Mäuse Zugang zu Zucker erhielten, wurden diese Neuronen aktiv und förderten ihren Appetit. Interessanterweise schütteten die Neuronen nicht nur Sättigungssignale aus, sondern auch das körpereigene Opiat ß-Endorphin, das ein Belohnungsgefühl auslöst und die Mäuse dazu bringt, Zucker über das Sättigungsgefühl hinaus zu konsumieren.
Diese opioidgesteuerte Belohnungsbahn im Gehirn wurde speziell aktiviert, wenn die Mäuse zusätzlichen Zucker aßen, nicht jedoch bei normaler oder fettreicher Nahrung. Als die Forscher diesen Weg blockierten, verzichteten die Mäuse auf zusätzlichen Zucker. Dieser Effekt trat jedoch nur bei gesättigten Tieren auf; bei hungrigen Mäusen hatte die Hemmung der ß-Endorphin-Freisetzung keine Wirkung.
Interessanterweise wurde dieser Mechanismus bereits aktiviert, wenn die Mäuse den Zucker wahrnahmen, bevor sie ihn aßen. Zudem wurde das Opiat auch in den Gehirnen von Mäusen freigesetzt, die zuvor noch nie Zucker konsumiert hatten. Sobald die erste Zuckerlösung in den Mäulern der Mäuse ankam, wurde ß-Endorphin in der „Dessert-Magen-Region“ freigesetzt, was durch zusätzlichen Zuckerkonsum weiter verstärkt wurde.
Die Forscher führten auch Gehirnscans bei Freiwilligen durch, die eine Zuckerlösung über einen Schlauch erhielten. Sie stellten fest, dass dieselbe Gehirnregion auf den Zucker bei Menschen reagierte. In dieser Region gibt es, wie bei Mäusen, viele Opiatrezeptoren in der Nähe von Sättigungsneuronen.
„Aus evolutionärer Sicht ergibt das Sinn: Zucker ist in der Natur selten, liefert aber schnelle Energie. Das Gehirn ist darauf programmiert, die Zuckeraufnahme zu kontrollieren, wann immer er verfügbar ist“, erklärt Henning Fenselau, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung und Leiter der Studie.
Die Erkenntnisse der Forschungsgruppe könnten auch für die Behandlung von Fettleibigkeit von Bedeutung sein. „Es gibt bereits Medikamente, die Opiatrezeptoren im Gehirn blockieren, aber der Gewichtsverlust ist geringer als bei appetitzügelnden Injektionen. Wir glauben, dass eine Kombination mit diesen oder anderen Therapien sehr nützlich sein könnte. Allerdings müssen wir dies weiter untersuchen“, sagt Fenselau.

☕︎ Unterstütze IT BOLTWISE® und trete unserem exklusiven KI-Club bei - für nur 1,99 Euro im Monat:
- NIEDLICHER BEGLEITER: Eilik ist der ideale Begleiter für Kinder und Erwachsene, die Haustiere, Spiele und intelligente Roboter lieben. Mit vielen Emotionen, Bewegungen und interaktiven Funktionen.
- Die besten Bücher rund um KI & Robotik!
- Die besten KI-News kostenlos per eMail erhalten!
- Zur Startseite von IT BOLTWISE® für aktuelle KI-News!
- Service Directory für AI Adult Services erkunden!
- IT BOLTWISE® kostenlos auf Patreon unterstützen!
- Aktuelle KI-Jobs auf StepStone finden und bewerben!
Stellenangebote

Software-Entwickler SAP Vermittler Provision (all genders) KI, HH, MS, DUS, DET

Werkstudent für den Bereich Data Experience: Fokus Data Science & AI (all genders) bei Personal Investors

AI Consultant (m/w/d)

KI-Ingenieur / AI Engineer (m/w/d)

- Die Zukunft von Mensch und MaschineIm neuen Buch des renommierten Zukunftsforschers und Technologie-Visionärs Ray Kurzweil wird eine faszinierende Vision der kommenden Jahre und Jahrzehnte entworfen – eine Welt, die von KI durchdrungen sein wird
- Künstliche Intelligenz: Expertenwissen gegen Hysterie Der renommierte Gehirnforscher, Psychiater und Bestseller-Autor Manfred Spitzer ist ein ausgewiesener Experte für neuronale Netze, auf denen KI aufbaut
- Obwohl Künstliche Intelligenz (KI) derzeit in aller Munde ist, setzen bislang nur wenige Unternehmen die Technologie wirklich erfolgreich ein
- Wie funktioniert Künstliche Intelligenz (KI) und gibt es Parallelen zum menschlichen Gehirn? Was sind die Gemeinsamkeiten von natürlicher und künstlicher Intelligenz, und was die Unterschiede? Ist das Gehirn nichts anderes als ein biologischer Computer? Was sind Neuronale Netze und wie kann der Begriff Deep Learning einfach erklärt werden?Seit der kognitiven Revolution Mitte des letzten Jahrhunderts sind KI und Hirnforschung eng miteinander verflochten
Du hast einen wertvollen Beitrag oder Kommentar zum Artikel "Warum wir trotz Sättigung nach Süßem verlangen: Ein Blick auf die Gehirnmechanismen" für unsere Leser?










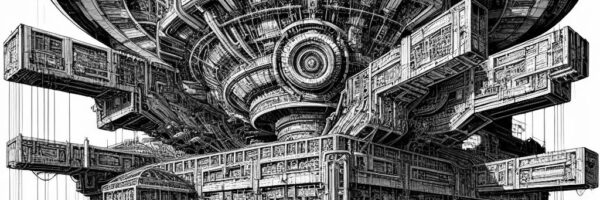
 #Sophos
#Sophos
Es werden alle Kommentare moderiert!
Für eine offene Diskussion behalten wir uns vor, jeden Kommentar zu löschen, der nicht direkt auf das Thema abzielt oder nur den Zweck hat, Leser oder Autoren herabzuwürdigen.
Wir möchten, dass respektvoll miteinander kommuniziert wird, so als ob die Diskussion mit real anwesenden Personen geführt wird. Dies machen wir für den Großteil unserer Leser, der sachlich und konstruktiv über ein Thema sprechen möchte.
Du willst nichts verpassen?
Du möchtest über ähnliche News und Beiträge wie "Warum wir trotz Sättigung nach Süßem verlangen: Ein Blick auf die Gehirnmechanismen" informiert werden? Neben der E-Mail-Benachrichtigung habt ihr auch die Möglichkeit, den Feed dieses Beitrags zu abonnieren. Wer natürlich alles lesen möchte, der sollte den RSS-Hauptfeed oder IT BOLTWISE® bei Google News wie auch bei Bing News abonnieren.
Nutze die Google-Suchmaschine für eine weitere Themenrecherche: »Warum wir trotz Sättigung nach Süßem verlangen: Ein Blick auf die Gehirnmechanismen« bei Google Deutschland suchen, bei Bing oder Google News!